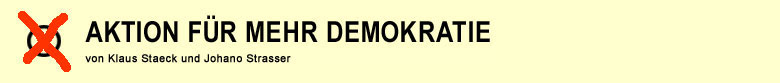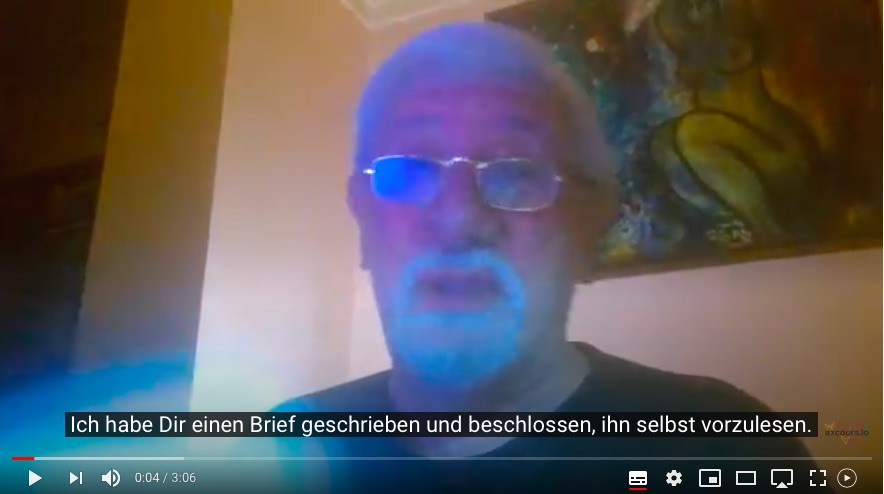Die Vorsitzende der Länder-Rundfunkkommission, Malu Dreyer (SPD), hat davor gewarnt, dass CDU und AfD in Sachsen-Anhalt gemeinsam ein Veto gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags einlegen. Dreyer sagte, wenn beide Parteien den Medienstaatsvertrag verhindern würden, wäre das ein politischer Dammbruch. In Sachsen-Anhalt werde aktuell nicht nur um eine Anpassung des Beitrags gerungen, sondern um eine vielfältige Medienlandschaft, zu der der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazugehört. Die CDU bringe nicht nur mit Rechtsextremen den Rundfunkstaatsvertrag zum Scheitern, sie würde auch eine Säule der Demokratie schleifen: die Medienvielfalt. Malu Dreyer hat die Bundes-CDU zum Eingreifen in Sachsen-Anhalt aufgefordert. Sie könne das nicht einfach laufen lassen.
(Quelle: dpa / AFP, 6.12.2020)
Öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken und neuem Rundfunkbeitrag zustimmen
Für die Medien- und Netzpolitische Kommission des SPD-Parteivorstandes sprechen sich die beiden Vorsitzenden Heike Raab und Carsten Brosda für die von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) empfohlene Anhebung des Rundfunkbeitrags aus.
„Die Erhöhung von 0,86 Cent ist nicht nur sach- und bedarfsgerecht, sie sichert auch die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ist für die Demokratie und die demokratische Kultur in unserem Land unbedingt notwendig.
Sollte im Dezember die CDU-Fraktion im sachsen-anhaltinischen Landtag gemeinsam mit der AfD die Ratifizierung des 1. Medienänderungsstaatsvertrages verhindern, wäre das in erster Linie ein politischer Dammbruch. Die KEF hat ihre Empfehlung staatsfern und pluralistisch getroffen und sachlich begründet. Die Länder haben diese 1:1 im Staatsvertrag umgesetzt. Die Empfehlung der KEF wird auch die Basis für mögliche Klagen der öffentlich-rechtlichen Anstalten gegen die nicht auftragsgemäße Finanzierung sein, die wahrscheinlich Aussicht auf Erfolg haben.
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben auch die Anliegen der ostdeutschen Länder aufgenommen, sowohl in der Programmgestaltung und als auch bei der Produktion ganz Deutschland in den Blick zu nehmen.
Die Erhöhung des Rundfunkbeitrages ist somit begründet und überfällig, denn seit 2009 wurde der Beitrag nicht mehr erhöht. Gleichzeitig sind aber über all die Jahre die Tariflöhne gestiegen, Produktionen haben sich verteuert und Investitionen in die digitale Transformation sind hinzugekommen.
Wir appellierten an die gewählten Abgeordneten für den Staatsvertrag zu stimmen, denn freie Medien gibt es nur in lebendigen Demokratien. Deshalb ist es auch eine Aufgabe der Unionsführung insgesamt, dafür zu sorgen, dass hier nicht mutwillig und gemeinsam mit der AfD die Axt an unsere Medienordnung gelegt wird. Wir erwarten von der CDU, ihre gesamtstaatliche Verantwortung für den Erhalt eines freien und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks ernst zu nehmen und davon auch die Parteikolleginnen und –kollegen in Sachsen-Anhalt zu überzeugen.“
Sind 86 Cent das wert?
Die Landtagsabgeordneten der CDU in Sachsen-Anhalt sind bereit, mit der AfD gemeinsame Sache in der Rundfunkpolitik zu machen. Sie setzen nicht nur ihre Regierungskoalition aufs Spiel. Es geht um mehr. Klaus Staecks Kolumne vom 26.11.2020 (veröffentlicht in der Berliner Zeitung und in der Frankfurter Rundschau)
DIE TAGESZEITUNG, 07.12.2020
„Der rechte CDU-Flügel in Sachsen-Anhalt fühlt sich der AfD näher als den mitregierenden Grünen. Er stimmt denselben verächtlichen Tonfall an, den die rechtsextreme AfD setzt: Für sie sind die Öffentlich-Rechtlichen eine linksgrün versiffte Propagandamaschine, die aufrechte BürgerInnen indoktriniert. Die AfD hasst kritischen Journalismus, weil er ihre Schwächen offenlegt. Darf man der Ansicht sein, die Anstalten brauchten nicht mehr Geld, obwohl die 86 Cent mehr de facto die erste Gebührenerhöhung seit 2009 sind? Selbstverständlich. Aber den Kontext der Debatte so konsequent zu ignorieren, wie es die Bundesspitze der CDU tut, ist gefährlich und falsch.“
Update 08.12.2020: Sachsen-Anhalt stoppt Erhöhung des Rundfunkbeitrages
In der Debatte um die Anhebung des Rundfunkbeitrags wird Sachsen-Anhalt dem Staatsvertrag nicht zustimmen. Ministerpräsident Reiner Haseloff kündigte am Dienstag (08.12.2020) an, das Gesetz zurückzuziehen. Medienausschuss und Landtag werden sich folglich nicht mit dem Thema befassen. Der Medienstaatsvertrag ist damit gescheitert. Die geplante Beitragsanpassung wird bundesweit blockiert, wenn nicht alle Landesparlamente dem Vorhaben bis Jahresende zustimmen.
Die Fraktionen von CDU, SPD und Grünen hätten mitgeteilt, dass es unterschiedliche Auffassungen zum Staatsvertrag gebe, hieß es aus der Staatskanzlei. Daraus folge, dass es im Landtag keine Mehrheit für das Vorhaben gebe.