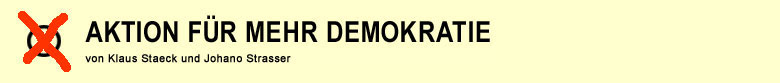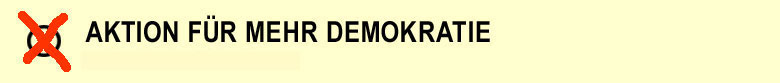Wahlaufruf vom 18. Oktober 2018
Thorsten Schäfer-Gümbel stellt sich den Herausforderungen der Zeit: Die Arbeitswelt wird digital. Die Freiheit von Kunst und Journalismus wird in vielen Ländern bedroht. Menschenrechte werden missachtet oder lächerlich gemacht, Sexismus und Rassismus greifen um sich. Der Klimawandel schreitet voran.
Thorsten Schäfer-Gümbel gestaltet Gesellschaft: Er begreift Digitalisierung als Chance, kämpft als überzeugter Sozialdemokrat für Freiheit und Menschlichkeit und ist sich unserer Verantwortung für die Bewahrung unserer natürlichen Umwelt bewusst. Wir sind überzeugt, dass sein zukunftsgewandter Optimismus mit Mut und konkreten, durchdachten Plänen der richtige Weg in eine gute Zukunft für alle ist.
Thorsten Schäfer-Gümbel sieht die Kraft der Kunst: Sie ist seit jeher ein Weg, um uns das vermeintliche Fremde nah zu bringen, um unsere Empathie zu wecken, unangenehme Fragen zu stellen und neue Möglichkeitsräume zu öffnen. Deshalb setzt er sich seit vielen Jahren dafür ein, dass möglichst viele Menschen diese Erfahrungen mit und durch Kunst machen dürfen.
Wir unterstützen Thorsten Schäfer-Gümbel, weil sein Engagement für Kunst und Kultur über rote Teppiche und feierliche Reden hinausreicht. Er steht unverbrüchlich an der Seite von Kunst- und Kulturschaffenden. Das haben wir immer wieder erlebt, etwa in der Debatte um das Urheberrecht.
Wir unterstützen Thorsten Schäfer-Gümbel, weil er Augen und Ohren hat für die Kraft der Kultur. Die braucht es gerade jetzt in einer Zeit, in der sogar faschistische Parolen wieder offen auf den Straßen zu hören sind. Faschistisches Denken ist menschenverachtend und widerspricht den Grundwerten unserer demokratischen Gesellschaft.
Wir unterstützen Thorsten Schäfer-Gümbel, weil wir seine sozialdemokratischen Prinzipien, sein Auge auf das, was in der Zukunft wichtig sein wird und seine besonnene Vernunft schätzen. Mit ihm wird die Zukunft gerechter, verantwortungsvoll und solidarisch gestaltet.
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner
Hatice Akyün, Schriftstellerin
Deniz Alt, Künstler
Adriana Altaras, Schriftstellerin
Ingeborg Arnold, Kulturforum Sachsen Anhalt
Adelheid Bahr, Germanistin
Alexander von Berswordt, Kunstvermittler
Yannic Bill, Kulturfabrik eigenArt e.V.
Manfred Bissinger, Publizist
Klaus Bochmann, Romanist
Renate Bochmann, Hochschullehrerin
Thomas Bockelmann, Theaterintendant
Peter Brandt, Historiker und Publizist
Fred Breinersdorfer, Drehbuchautor
Manfred Butzmann, Künstler
Pepe Danquart, Filmemacher
Renan Demirkan, Schauspielerin/Schriftstellerin
Judith Döker, Schauspielerin
Friedel Drautzburg, Gastrosoph
Hannah Dübgen, Schriftstellerin
Benedikt Dyrlich, Schriftsteller
Siegmund Ehrmann, ehem. MdB
Vito von Eichborn, Verleger
JOANA Emetz, Liedermacherin
Uwe Fahrenkrog-Petersen, Musikproduzent
Niklas Frank, Autor
Uwe Friesel, Schriftsteller
Udo Geiseler, Kulturpolitiker
Hans W. Geissendörfer, Filmregisseur
Günter Gentsch, Schriftsteller
Eberhard Görner, Filmemacher
Heide Görner, Fachärztin
Dietlind Grabe-Bolz, Musikerin
Bernhard von Grünberg, Geschäftsführer
Annette Gümbel, Historikerin
Jörg Hafkemeyer, Publizist
Michael Haerdter, Publizist
Karin Hartmann, MdL Hessen
Ina Hartwig, Autorin
Volker Hauff, Publizist
Gert Heidenreich, Schriftsteller
Frank Henschke, Produzent
Nele Hertling, Dramaturgin
Uwe Karsten Heye, Publizist
Jochen Hörisch, Germanist
Michael Hohmann, GF Romanfabrik F
Bettina Huber, Kommunikationswissenschaftlerin
Verena Hubertz, Gründerin/Geschäftsführerin
Felix Huby, Schriftsteller
Rolf Johanning, Kulturdezernent a.D.
Christopher Kopper, Historiker
Olaf Ihlau, Publizist
Siegfried Kaden, Künstler
Till Kaposty-Bliss, Verleger
Inge Karst-Staeck, Soziologin
Aykut Kayacik, Schauspieler
Gisela Kayser, Freundeskreis Willy-Brandt-Haus
Reinhard Klimmt, Publizist
Ina Paule Klink, Schauspielerin
Kirsten Klöckner, Künstlerin
Sebastian Krumbiegel, Musiker
Miriam Küllmer-Vogt, Künstlerin
Michael Kumpfmüller, Schriftsteller
Helmut Lachenmann, Komponist
Stefanie Lemke, Kommunikationswissenschaftlerin
Anne Linsel, Kulturjournalistin
Hans-Werner Meyer, Schauspieler
Kristin Meyer, Schauspielerin
Rune Mields, Malerin
Regine Möbius, Schriftstellerin
Ursela Monn, Schauspielerin
Oskar Negt, Soziologe
Hans-Bernhard Nordhoff, Kulturdezernent a.D.
Christian Nürnberger, Publizist
Axel Pape, Schauspieler
Roswitha Josefine Pape, Künstlerin
Carla L. Pehle, Gruppenanalytikerin
Walter H. Pehle, Historiker
Wolfgang Petrovsky, Künstler
Gerhard Pfennig, Rechtsanwalt
Lothar C. Poll, Rechtsanwalt
Willy Praml, Regisseur
Karl-Klaus Rabe, Verleger
Volker Rattemeyer, Kunsthistoriker
Hilde Rektorschek, Bundesverband Kulturlogen
Tim Renner, Musikproduzent
Christian Robbe, Journalist
Lea Rosh, Vors. Förderkreis „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“
Heinrich Schafmeister, Schauspieler
Werner Schaub, Künstler
Klaus-Jürgen Scherer, Politologe
Oliver Scheytt, Kulturmanager
Clemens Schick, Schauspieler
André Schmitz, Staatssekretär a.D.
Friedrich Schorlemmer, Theologe
Armin Schubert, Bücherkinder Brandenburg
Hjalmar Schuck
Jürgen Schweinebraden, Verleger
Olaf Schwencke, Publizist
Bernhard Schwichtenberg, Künstler
Tina Schwichtenberg, Künstlerin
Walter Sittler, Schauspieler
Maria Sommer, Bühnenverlegerin
Tilman Spengler, Schriftsteller
Franziska Sperr, Autorin
Klaus Staeck, Grafiker
Gerhard Steidl, Verleger
Johano Strasser, Schriftsteller
Jan Strecker, Berater
Winfried Sühlo, Historiker
Stefan Thome, Schriftsteller
Jörg-Philipp Thomsa, Günter-Grass-Haus
Heidemarie Vahl, Museumsleiterin a.D.
Christina Weiss, Journalistin
Ernst Ulrich von Weizsäcker, Naturwissenschaftler
Patrick Winczewski, Filmregisseur
Jörg W. Ziegenspeck, Schriftsteller
Olaf Zimmermann, Publizist
(Stand 23.10.2018)
Zukunft solidarisch gestalten (pdf-Dokument zum Download)